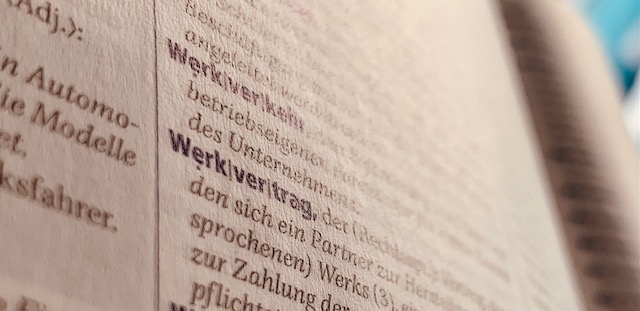
Werkvertrag – Infos und Tipps
Werkvertrag – Sie haben Fragen?
Wir beraten bundesweit zum Thema Werkvertragsrecht:
– kostenlose Erstberatung
– kompetente Beratung vom Rechtsanwalt
– profitieren Sie von mehr als 20 Jahren Berufserfahrung
Fragen:
Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. (§ 631 BGB)
Der Werkvertrag sollte die wichtigsten Punkte regeln: 1. detaillierte Beschreibung des zu erstellenden Werks. Muss das Werk erst noch geplant werden, muss eine Planungsphase geregelt werden. 2. Ausführungsfristen/ Fertigstellungsfristen 3. Vergütung/ Werklohn 4. Abnahmeregelung/ Testszenarien 5. Kündigung 6. Gewährleistung
Mit einem Pflichtenheft (oder auch Lastenheft oder Spezifikation) legen Auftraggeber und Werkunternehmer gemeinsam die genauen Deteils der Beschaffenheit des zu erstellenden Werks fest. Bei einem Softwareerstellungsvertrag ist das Pflichtenheft die zentrale Leistungsvorgabe. Gem. Rechtsprechung ist grundsätzlich der Auftraggeber zur Stellung des Pflichtenhefts verpflichtet. Im Vertrag sollten Verantwortlichkeiten für die Erstellung des Pflichtenhefts geregelt werden.
Typische Werkverträge sind der Softwarerrstellungsvertrag, der Vertrag über die Errichtung eines Hauses/ Gebäudes (Fertighausvertrag), Steuerberatervertrag über die Erstellung einer Steuererklärung, KFZ-Reparaturvertrag.
Inhalt:
- Werkvertrag – Was ist das?
- Vorteile Werkvertrag
- Nachteile Werkvertrag
- Werkvertrag kündigen
- Werkvertrag Rücktritt
- Werkvertrag Gewährleistung
- Werkvertrag & Abnahme
- Werkvertrag – Vertragsgestaltung Tipps
Werkvertrag – Infos und Tipps
Neben dem Dienstvertrag (§ 611 ff BGB) steht der Werkvertrag (§ 631ff BGB). Beide Verträge kommen alltäglich vor und werden bei der Erledigung von Aufträgen genutzt. Die Einsatzgebiete sind vielfältig. Beispielsweise genannt seien die Bereiche der IT mit EDV, Software, Wartung, die Bereiche der Bauunternehmung mit Haus und Wohnungsbau (Bauvertrag), die Bereiche des Facility-Managements. Die Frage hier soll sein, was ist ein Werkvertrag und was ist zu beachten. Welche Rechte und Pflichten gelten? Was unterscheidet den Werkvertrag vom Dienstvertrag? In dem Ratgeber haben wir hierzu einige wichtige Punkte zusammengestellt.
Werkvertrag – Definition nach § 631 BGB
Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer (Auftragnehmer) zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller (Auftraggeber) zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Der Werkvertrag ist ein speziell geregelter Vertragstyp im BGB, dort zu finden unter §§ 631 BGB.
Wichtig ist für die Abgrenzung eines Werkvertrags zu anderen Vertragstypen insbesondere die Verpflichtung des Werkunternehmers, ein Werk herzustellen. Was alles als herzustellendes Werk in Betracht kommen kann, soll die nachfolgende Aufstellung zeigen:
- Programmierung von Software oder einer Webseite
- Installation von Software
- Wartung und Support von Software
- Beauftragung von Architekten zur Planung eines Hauses
- Errichtung eines Gebäudes; Errichtung einzelner Gewerke; Bauvertrag
- Reparatur eines Fahrzeugs
- Anfertigung einer Steuererklärung durch den Steuerberater
- Anfertigung von Gutachten, Bescheinigungen, Zertifizierungen
- Wartung von Geräten und Gebäuden
- Konkret geschuldete Werbeleistungen einer Werbeagentur, wie z.B. Erstellung eines Logos oder eines Flyers
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Werkunternehmer beim Werkvertrag einen konkreten Erfolg herbeizuführen hat. Er muss das Werk so liefern, wie es vereinbart wurde. Im Gegenzug bekommt der Werkunternehmer für die Herstellung die vereinbarte Vergütung, den Werklohn. Je nach Auftrag können die zuvor genannten Regelungen aber auch einem anderen Vertrag, etwa einem Dienstvertrag zuzuordnen sein, und zwar dann, wenn nicht die Herstellung im Vordergrund steht. Die Abgrenzung des Werkvertrags von einem Dienstvertrag ist oftmals nicht einfach.
Hauptleistungspflicht des Werkunternehmers, die Herstellung des geschuldeten Werks – § 631 BGB
Der Werkunternehmer ist beim Werkvertrag verpflichtet, das vereinbarte Werk rechtzeitig und vertragsgemäß herzustellen und zu liefern. Die Herstellung ist Hauptleistungspflicht und im Gesetz unter § 631 BGB geregelt. Hierbei gilt es zu beachten, dass das Werk die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen muss. Wurde hierzu vertraglich keine Vereinbarung getroffen, muss das Werk grob gesagt fachgerecht und für den Einsatzzweck geeignet sein. Die gesetzlichen Regeln finden sich hierzu in § 633 BGB.
Hauptleistungspflicht des Bestellers, die Zahlung der Vergütung – § 631 BGB
Wichtig zu wissen ist beim Werkvertrag, dass die Vergütung gem. Gesetz grundsätzlich erst bei erfolgreicher Abnahme des Werks zu zahlen ist. Wurde das Werk erfolgreich abgenommen, ist die Vergütung – der vereinbarte Werklohn – zu zahlen.
Wurde keine genaue Vergütung vertraglich vereinbart, ist gem. Gesetz eine marktübliche Vergütung zu zahlen, § 632 Abs. 2 BGB.
An dieser Stelle könnte man die Ausführungen beenden, wenn das geschuldete Werk ordnungsgemäß und rechtzeitig zur vollen Zufriedenheit des Bestellers hergestellt und geliefert wurde und der Besteller an den Werkunternehmer den vereinbarten Werklohn pünktlich gezahlt hat. Das Recht kommt aber immer gerade dann zu Anwendung, wenn etwas nicht planmäßig oder zufriedenstellend läuft, also das geschuldete Werk nicht den Erwartungen des Bestellers entspricht oder der Werkunternehmer ewig auf sich warten lässt. Aber auch dann, wenn der Besteller nicht oder nicht pünktlich die vereinbarte Vergütung zahlt, ist Streit vorprogrammiert.
Vor- und Nachteile des Werkvertrags
Was sind die Vorteile eines Werkvertrags? Was sind die Nachteile? Grundsätzlich kann man sagen, dass der Werkvertrag – im Gegensatz zum Dienstvertrag – für den Auftraggeber Vorteile bringt. Im Umkehrschluss ergeben sich hieraus Nachteile für den Auftragnehmer, den Werkunternehmer.
Vorteile eines Werkvertrags für den Auftraggeber:
- Der Werkvertrag beinhaltet Gewährleistungsansprüche, welche es beim Dienstvertrag nicht gibt.
- Zudem ist die Vergütung grundsätzlich erst fällig, wenn die Abnahme des Werks erfolgt ist.
- Ein Werkvertrag kann jederzeit frei durch den Auftraggeber gekündigt werden.
“Nachteile” eines Werkvertrags für den Auftragnehmer:
- Der Auftraggeber hat einen Vergütungsanspruch erst mit erfolgter Abnahme.
- Der Auftraggeber unterliegt den Pflichten der Gewährleistung.
- Der Auftraggeber trägt das größere Risiko im Falle eines Scheiterns des zu erstellenden Werks.
Streitfragen im Werkvertragsrecht:

Der Werkunternehmer braucht ewig, wie lange muss der Besteller warten?
Wurde in einem Werkvertrag eine bestimmte Lieferfrist vereinbart, ist die Frage recht klar zu beantworten. Der Werkunternehmer muss das Werk innerhalb der vereinbarten Lieferfrist liefern. Überschreitet der Werkunternehmer die vertraglich vereinbarte Lieferfrist, kann der Besteller eine angemessene Nachfrist setzen. Erfolgt auch dann keine Lieferung des Werks, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen. Dem Werkunternehmer steht in einem solchen Fall keine Vergütung zu. Zudem muss der Werkunternehmer dem Besteller einen entstandenen Schaden ausgleichen. Neben dem Rücktritt kann der Werkvertrag auch fristlos gekündigt werden (§ 648a BGB). Die Frage, ob ein Rücktritt oder eine fristlose Kündigung besser ist, muss für den Einzelfall geprüft werden.
Das gelieferte Werk entspricht nicht den Erwartungen des Bestellers, was ist zu tun?
Wenn das gelieferte Werk nicht den Erwartungen des Bestellers entspricht, ist zu prüfen, ob das Werk mangelhaft ist. Hierbei ist entscheidend, ob das Werk bereits abgenommen wurde oder noch nicht.
Wurde das Werk noch nicht abgenommen, muss der Werkunternehmer beweisen, dass das Werk der vertragliuchen Beschaffenheit entspricht.
Wurde das Werk dagegen abgenommen, ist der Besteller in der Beweispflicht, dass ein Mangel vorliegt.
Ob ein Mangel vorliegt, muss anhand der vertraglichen Vereinbarungen geprüft werden. Je konkreter die Vereinbarungen sind, desto besser, da dann anhand der Vereinbarungen konkret geprüft werden kann, ob die vereinbarten Eigenschaften umgesetzt wurden. Liegen hierzu keine vertraglichen Vereinbarungen vor, ist die Prüfung der vertragsgemäßen Beschaffenheit schon schwieriger. Hier muss geprüft werden, ob die Beschaffenheit fachgerecht und den allgemeinen Erwartungen entspricht. Gegebenenfalls muss die Beschaffenheit durch einen Sachverständigen geprüft werden.
Werkvertrag kündigen, ist eine vorzeitige Beendigung des Werkvertrags möglich?
Freie Kündigung des Werkvertrags durch den Besteller gem. § 648 BGB
Der Besteller (Auftraggeber) kann den Werkvertrag jederzeit kündigen mit der sogenannten freien Kündigung, diese ist im Gesetz in § 648 BGB geregelt. Allerdings muss der Besteller dem Werkunternehmer (Auftragnehmer) in einem solchen Fall den vereinbarten Werklohn zahlen, jedoch unter Abzug der ersparten Aufwendungen des Werkunternehmers. Im Werkvertragsrecht wird gesetzlich vermutet, dass die ersparten Aufwendungen bei ca. 95% liegen und der Werkunternehmer einen Werklohnanspruch in Höhe von 5 Prozent der vereinbarten Vergütung hat. Hierzu muss man jedoch sagen, dass dieser Wert meistens nicht der Realität entspricht, da der kalkulierte Gewinnanteil oftmals bereits die 5% überschreitet. Kann der Werkunternehmer daher nachweisen, dass seine ersparten Aufwendungen niedriger sind, kann dies dazu führen, dass ein wesentlich höherer Anteil der Vergütung bis sogar zum vollen Werklohn zu zahlen ist. Gleiches gilt, wenn bereits Leistungen erbracht worden sind. Die Berechnung der Vergütung nach § 648 BGB (rechtlich handelt es sich nicht um einen Vergütungsanspruch) ist oftmals mit erheblichen schwierigkeiten verbunden. Unter Umständen kann der Werkunternehmer verpflichtet sein, eine Kalkulation offen zu legen.
Kündigung Werkvertrag nach § 648 BGB (§ 649 BGB a.F.)
Sie haben Fragen zur freien Kündigung des Werkvertrags nach § 648 BGB?
Sie haben Fragen zu einer Abrechnung eines Werkvertrags nach freier Kündigung
Kündigung des Werkvertrags aus wichtigem Grund gem. § 648a BGB
Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Werkvertrag fristlos aus wichtigem Grund gekündigt werden. Das Kündigungsrecht besteht bei vorliegen eines wichtigen Grundes sowohl für den Auftragnehmer als auch für den Auftraggeber.
Anders als beim Rücktritt findet im Fall der fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund keine Rückabwicklung statt. Der Werkunternehmer kann hiernach noch einen Zahlungsanspruch haben, sofern die Leistungen (teilweise) brauchbar sind. Der Auftraggeber muss bereits empfangene Leistungen unter Umständen nicht zurückgeben.
Ist die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund wirksam, können Schadensersatzansprüche bestehen. Anspruchsberechtigt für einen Schadensersatzanspruch können sowohl der Werkunternehmer als auch der Auftraggeber sein.
Kündigung des Werkvertrags durch den Werkunternehmer bei unterlassener Mitwirkung
Kündigung des Auftragnehmers gem. § 643 BGB: Kommt der Besteller (Auftraggeber) seinen Mitwirkungspflichten nicht nach, kann der Werkunternehmer (Auftragnehmer) dem Besteller eine angemessene Frist zur Nachholung der Mitwirkung setzen. Hierzu muss der Werkunternehmer dem Besteller androhen, dass er den Werkvertrag bei nicht fristgerechter Mitwirkung kündigt. Läuft die gesetzte Nachfrist dann erfolglos ab, kann der Werkunternehmer den Werkvertrag kündigen. Zu beachten ist hier bei Kündigung auch ein Entschädigungsanspruch des Werkunternehmers.
Rücktritt vom Werkvertrag
Der Besteller (Auftraggeber) kann unter bestimmten Voraussetzungen auch vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist im Gesetz in § 634 BGB geregelt. Ein Rücktrittsrecht vom Werkvertrag besteht hiernach bei wesentlichen Mängeln. Das Rücktrittsrecht besteht so lange, wie die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bestehen.
Für den Werkunternehmer stellt das Rücktrittsrecht vom Vertrag eine nicht unerhebliche Gefahr dar, da der als Auftragnehmer im Falle eines Rücktritts ohne jegliche Vergütung ausgeht und zudem gegebenenfalls sogar noch Schadensersatz an den Auftraggeber zahlen muss. Bei Rücktritt ist das Werkvertragsverhältnis rückabzuwickeln, dies bedeutet dass der Auftraggeber alles was er erlangt hat an den Auftragnehmer herauszugeben hat und der Auftragnehmer bereits erhaltene Zahlungen zurückzuzahlen hat. Ein Anspruch auf Vergütung besteht für den Unternehmer in diesem Fall nicht.
Alternativ zum Rücktritt vom Vertrag kann es daher oftmals gerade bei kleineren Mängeln sinnvoll sein, den Anspruch auf Minderung der Werkvergütung gemäß § 638 BGB geltend zu machen. In diesem Fall besteht jedoch kein Rücktrittsrecht vom Werkvertrag mehr. Rücktritts- und Minderungsrecht schließen sich gegenseitig aus. Auch ein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund sollte in Betracht gezogen werden.
Abnahme Werkvertrag § 640 BGB
Bei der Abnahme handelt es sich um eine Erklärung, mit welcher der Auftraggeber bescheinigt, dass das erstellte Werk den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Grundsätzlich handelt es sich bei der werkvertraglichen Abnahme um eine echte Erklärung, welche mündlich oder aber auch schriftlich erfolgen kann. Daneben gibt es aber auch die stillschweigende Abnahme, welche etwa dann anzunehmen ist, wenn der Auftraggeber das Werk ohne Beanstandung entgegennimmt und bestimmungsgemäß nutzt.
Wann muss der Besteller das Werk abnehmen?
Der Besteller (Auftraggeber) muss bei vertragsgemäßer Herstellung des Werks die Abnahme erklären. Insofern besteht eine Abnahmepflicht. Die Annahme ist im Gesetz unter § 640 BGB geregelt. Die Abnahmepflicht besteht grundsätzlich jedoch nur dann, wenn das Werk vollständig fertiggestellt ist. Weist das Werk nur geringfügige Mängel auf, die die Gebrauchsfähigkeit nicht beeinschränken, berechtigt dies jedoch nicht zur Verweigerung der Abnahme. Allerdings bleiben auch bzgl. geringfügiger Mängel Mängelrechte bestehen. Für die Abnahme zeigt der Unternehmer die Fertigstellung des Werkes an. Bei erfolgreicher Prüfung des Werkes erklärt der Besteller die Abnahme. Die Abnahme kann grundsätzlich auch formlos erklärt werden, etwa bei einer Autoreparatur.
Gewährleistung beim Werkvertrag
Beim Werkvertrag besteht eine Gewährleistung. Der Unternehmer muss innerhalb der Gewährleistungspflicht Mängel beseitigen. Liegt ein Mangel vor, muss der Besteller dem Unternehmer die Nacherfüllung bzw. Mängelbeseitigung einräumen. Bevor der Besteller auf Kosten des Unternehmers einen Mangel selbst beseitigen kann, muss er dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen. Kommt der Unternehmer seiner Pflicht zur Nacherfüllung nicht nach, kann der Besteller dann den Mangel auf Kosten des Werkunternehmers selbst beseitigen oder unter Umständen sogar vom Vertrag zurücktreten. Wichtig zu wissen: Auch beim Werkvertrag kann der Besteller die Kündigung aus wichtigem Grund erklären.
Tipps zur Vertragsgestaltung:
Bei komplexen und auch bei teuren Werken – etwa bei der Herstellung von Gebäuden/ Häusern, bei der Entwicklung von Software, bei der Lieferung und Installation von hochwertiger und komplexer Hard- und Software – sollte grundsätzlich ein detaillierter Werkvertrag geschlossen werden. In diesen Vertrag gehören wesentliche Punkte wie Lieferfristen, Werksbeschaffenheit, Mitwirkungspflichten. Der Besteller liefert grundsätzlich ein Lastenheft, was seine Anforderungen umschreibt. Anhand des Lastenheftes wird dann gemeinsam ein Pflichtenheft ausgearbeitet, welches die genaue Beschaffenheit des herzustellendes Werks beschreibt. Je detaillierter ein solches Pflichtenheft ausgestaltet ist, desto besser lässt sich anhand dessen die geschuldete Beschaffenheit des Werks prüfen. Viele Werkverträge sind leider nur unzureichend gestaltet. Dies führt in der Praxis dazu, dass Schwierigkeiten bei der Festlegung von Ansprüchen – etwa Zahlungsansprüchen, Mängelansprüchen oder Mitwirkungspflichten – bestehen.
Wichtige Vertragsinhalte für einen Werkvertrag:
- Detaillierte Beschreibung des Werkes: Das Werk ist je nach seiner Art so genau wie möglich im Vertrag zu beschreiben. Es ist sinnvoll, die Beschreibung gestaffelt mit einem Lastenheft und einem Pflichtenheft zu gestalten. Diese Dokumente werden dann in den Vertrag einbezogen. Hierein gehören beispielsweise die technische Beschreibung, der vertragliche Leistungsumfang, eventuell notwendige Planungsleistungen oder sonstige vorbereitenden Leistungen, bei Werkverträgen im Zusammenhang mit Hard- und Software beispielsweise notwendige Systemvoraussetzungen
- Lieferfristen: Sind Liefertermine gewollt, müssen diese auch in den Werkvertrag aufgenommen werden. Bei komplexen Werkverträgen empfielhlt sich ein gestaffelter Aufbau, etwa in Meilensteinen, gegebenfalls auch mit Zwischenabnahmen, wobei eine Zwischenabnahme keine Endabnahme ersetzt.
- Form der Lieferung: Da der Hersteller das Werk nicht nur herstellen, sondern auch liefern muss, sind hier im Vertrag die Formen der Lieferung vertraglich zu vereinbaren. Beispielsweise bei Software – Lieferung auf CD-Rom oder als Download
- Werklohn: Der Werklohn ist die Vergütung und sollte detailliert vereinbart werden. Gegebenfalls sollte hier ein Festpreis vertraglich vereinbart werden. Möglich sind aber auch monatliche Zahlungen. Wichtig für den Auftraggeber zur Planbarkeit der Kosten ist ein fester Kostenrahmen. Gegebenenfalls zu zahlende Zusatzkosten – wie beispielsweise Reisekosten, Übernachtungskosten, sind zu regeln. Die Vergütung kann grundsätzlich auch nach Zeitaufwand berechnet werden.
- Änderungswünsche/ change requests: Da sich bei der Herstellung von Werken immer wieder Änderungswünsche beim Auftraggeber auftun, bitte auch das Verfahren bzw. das Prozedere für die Umsetzung solcher Änderungswünsche festlegen. Hier ist auch daran zu denken, dass gegebenenfalls das Pflichtenheft bzw. die Leistungsbeschreibung angepasst werden muss, ebenso wie vereinbarte Lieferfristen.
- Abschlagszahlungen/ Vorschuss: Bei umfangreicheren Projekten sollten Abschlagszahlungen vereinbart werden, da ansonsten der Werkunternehmer die Herstellung komplett vorfinanzieren muss.
- Abnahme: Das Prozedere einer Abnahme sollte geregelt werden. Gerade im Bereich der IT sind vor Abnahme Tests durchzuführen. Hier empfiehlt sich die Regelung einer genauen Vorgehensweise für durchzuführende Tests. Zudem kann geregelt werden, welche Mängel in welcher Anzahl eine Abnahme zulassen.
- Kündigung durch Auftraggeber: Die Kündigung durch den Auftraggeber sollte gesondert geregelt werden. Im Falle einer freien Kündigung muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer das volle Honorar abzüglich der ersparten Aufwendungen zahlen. Gegebenfalls ist für den Anfang einer Planung ein kostengünstiges Ausstiegsszenario für den Auftraggeber festzuhalten. Gerade wenn ein Werkvertrag in zwei Phasen stattfinden – zunächst die Umsetzung geplant und nach Abschluss der Planungsphase die Umsetzung beginnt, sollte an Probleme bei der Planungsphase gedacht werden.
- Regelung von sonstigen Rechten: Bei IT-Angelegenheiten wie der Softwareerstellung aber auch bei anderen kreativen Leistungen spielen urheberrechtliche Fragen eine Rolle. Daher ist bereits bei Vertragsschluss zu regeln, welche Nutzungsrechte der Auftraggeber später in Bezug auf Uhrberrechte haben soll. Beispiel: Architekten genießen hinsichtlich von ihnen geplanter Architektenhäuser unter Umständen ein Urheberrecht, Änderungen am Haus dürften dann unter umständen nur mit Zustimmung des Architekten vorgenommen werden! Das Urheberrecht ist gesetzlich im UrhG geregelt.
IT-Projektvertrag
Im Zusammenhang mit dem IT-Projektvertrag haben wir ein Video mit wichtigen Punkten zusammengestellt, welche beachtet werden sollten.
Werkvertrag und Software
Im Bereich der Softwareerstellung spielt der Werkvertrag eine große Rolle. Softwarerstellungsverträge sind üblicherweise grundsätzlich als Werkvertrag einzustufen, und zwar egal ob es sich um einen klassischen Projektvertrag oder um eine agile Softwareentwicklung (SCRUM) handelt. Dies bedeutet, dass der Softwareprogrammierer bzw. das beauftragte Unternehmen die Fertigstellung einer mangelfreien Software schuldet. Wichtig ist dass darauf geachtet wird, dass die Planungsphase wie auch die Umsetzungsphase sauber geregelt sind. Planungsphase meint hier den Teil, in welchem die Softwareentwicklung geplant wird. Hierfür stellt der Auftraggeber üblichwerweise ein Lastenheft mit den notwendigen Funktionen zur Verfügung. Im Anschluss hieran erstellt der Softwareentwickler in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber ein Pflichtenheft bzw. eine sogenannte Spezifikation. Diese Spezifikation sollte möglichst detailliert die genauen Funktionalitäten der zu erstellenden Software umschreiben. Erst wenn das Pflichtenheft fertig gestellt und vom Auftraggeber abgenommen wurde, sollte mit der Programmierung der Software begonnen werden.
Werkvertrag und Baurecht
Der Bauvertrag ist ein klassischer Werkvertrag und regelt zwischen den Vertragsparteien eine Bauleistung. Der Bauvertrag ist z.B. ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks. Im Gesetz findet sich hierzu die Regelung des § 650a BGB. Bei dem Bauvertrag oder auch Architekten-Vertrag werden oftmals die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) einbezogen. Für die VOB gilt jedoch der Grundsatz, dass diese in den Vertrag ausdrücklich einbezogen werden müssen.
Abgrenzung zu anderen Vertragstypen/ gemischte Verträge
Die Abgrenzung des Werkvertrags von anderen Vertragstypen, wie beispielsweise dem Dienstvertrag bereitet oft Schwierigkeiten. Oftmals werden Verträge erstellt, der konkrete gesetzliche Vertragstyp wird jedoch erst spät in einem Rechtsstreit vor Gericht zugeordnet. Hinzu kommt, dass viele Verträge eine Mischung aus verschiedenen Vertragstypen sind. So kann beispielsweise ein Vertrag mit einer Werbeagentur ein Dienstvertrag sein, etwa wenn vorrangig die Beratung im Vordergrund steht. Einzelne Leistungen werden jedoch auch einem Werkvertrag zuzuordnen sein, wie die Umsetzung konkreter Werbemaßnahmen. Welcher Vertragstyp letztlich vorliegt, ist anhand einer Vertragsauslegung zu prüfen. Hierfür ist maßgeblich, was die Vertragsparteien gewollt haben. Nicht entscheidend ist hierbei, wie ein Vertrag betitelt ist. So kann auch ein Vertrag mit der Überschrift “Dienstvertrag” ein Werkvertrag sein, wenn Inhalt die Erstellung eines konkreten Werks (z.B. Software, Webseite) ist.
Werkvertrag und Arbeitnehmer
Der Werkvertrag taucht immer wieder im Zusammenhang mit Scheinselbständigen auf. Gängige Begriffe für arbeitnehmerüberlassungsähnliche Werkverträge sind Leiharbeit, Mitarbeiterüberlassung, Personalleasing, Temporärarbeit und Zeitarbeit. Gerade im Baugewerbe werden oftmals vermeintlich selbständige Subunternehmer beschäftigt, welche ihre Arbeitsleistung jedoch ausschließlich für einem Auftraggeber zu erbringen haben und sich hierbei auch noch an die Weisungen des Auftraggebers halten müssen. Scheinselbständigkeit liegt dann vor, wenn zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber tatsächlich eine Abhängigkeit wie bei einem Arbeitnehmer in einem Beschäftigungsverhältnis besteht. Die Abgrenzung ist nicht immer einfach. Die Folge einer solchen Scheinselbständigkeit ist, dass es sich dann tatsächlich um einen Arbeitsvertrag handelt und der Auftragnehmer als Arbeitnehmer eingestuft wird. Bei dem Arbeitsverhältnis handelt es sich dann um einen Dienstvertrag. Dies hat gravierende Folgen für den Auftraggeber, der dann Arbeitgeber ist. Probleme gibt es hier dann beispielsweise im Zusammenhang mit der Vorsteuer, mit den Lohnnebenkosten. Der Arbeitnehmer hat dann etwa Ansprüche auf Lohnfortzahlung, auf die Arbeitgeberzulagen etc.
Wir für Sie – kostenfreie Erstberatung
Wenn Sie sich Beratung/ Hilfe bei der Vertragserstellung/ Vertragsprüfung/ Forderungsdurchsetzung eines Werkvertrags oder anderer Vertragstypen benötigen, wenden Sie sich gerne an uns. Sie können uns telefonisch erreichen unter 0221 29780954. Oder schicken Sie uns eine Anfrage über unser Kontaktformular. Eine Erstberatung erhalten Sie bei uns kostenfrei.
Vielleicht auch Interessant, eine Zusammenstellung der Unterschiede zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag:

